Die Zivilgesellschaft in der Ukraine ist wie in vielen postkommunistischen Transformationsstaaten lange Zeit kaum wahrgenommen worden. Erst seit der maßgeblich durch Protagonisten eben jener Zivilgesellschaft getragenen „Orangenen Revolution“ von 2004 sind ihre Existenz und ihr Zustand vermehrt in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses gerückt. Insgesamt lassen sich zwei programmatische Aussagen treffen. Erstens: Die Zivilgesellschaft in Europas größtem Flächenstaat ist viel zu schwach, um annähernd die ihr in der Wissenschaft per definitionem zugedachte Rolle zu spielen. Zweitens: die wenigen vorhandenen Akteure unterliegen vor allem finanzieller und damit auch inhaltlicher Steuerung westlicher Interessenvertreter.
Der Begriff der Zivilgesellschaft wird häufig ebenso inflationär wie unscharf verwendet. Folgt man der Deutungsweise der renommierten Transformationsforscher Wolfgang Merkel und Hans-Joachim Lauth, so beschreibt der Terminus jene intermediäre Sphäre, die zwischen dem „Staat“ und dem „Privaten“ zu verorten ist. Innerhalb der Zivilgesellschaft agiert eine Vielzahl von auf das Allgemeinwohl gerichteten Organisationen, die durch institutionelle Autonomie, Heterogenität und Interessenpluralismus gekennzeichnet sind und denen als Grundkonsens die Prinzipien Toleranz, Fairness und Gewaltlosigkeit zugrunde liegen.
Ein Blick in die Geschichte der politischen Ideen zeigt ein sich dynamisch entwickelndes Konzept: Während John Locke einer civil society den Schutz des Individuums vor und die Sicherung seiner Rechte gegenüber dem willkürlichen Staat als Aufgaben übertrug und Charles de Montesquieu diesen Gegensatz zugunsten eines Gleichgewichts zwischen politischen Verantwortungsträgern und gesellschaftlichem Netzwerk ablöste, vertrat Alexis de Tocqueville schließlich die Idee eines vertikal diversifizierten und partizipatorisch organisierten Gemeinwesens, um so das innere Funktionieren des Staates zu gewährleisten. Hierbei fand sich das, was Ralf Dahrendorf fast 150 Jahre später als „Bürgergesellschaft“ formulierte, bereits in Ansätzen verwirklicht: ein aktives Zusammenwirken verschiedenster Organisationen unterhalb der staatlichen Ebene.
Mithilfe der Akzentuierungen innerhalb der genannten philosophischen Konzepte lassen sich auch die einzelnen Funktionen von Zivilgesellschaft identifizieren: Schutz der privaten vor der staatlichen Sphäre, Kontrolle staatlicher Macht, Rekrutierung demokratischer Eliten als zukünftige Entscheidungsträger, Aggregation und Artikulation gesellschaftlicher Interessen und schließlich die Vernetzung der lokalen mit der nationalen Ebene.
Die Transformationsforschung misst zivilgesellschaftlichen Akteuren eine für den Systemwechsel autokratischer bzw. totalitärer Staaten nicht unwichtige Bedeutung bei. Dafür unterscheidet sie drei idealtypische Phasen, die die Zivilgesellschaft zu ihrer Konsolidierung durchlaufen muss und die im Folgenden kurz beschrieben werden.
In der ersten, der „strategischen Phase“, formiert sich die Zivilgesellschaft aufgrund des repressiven autokratischen Regimes als strategische Einheit gegen das System. Interne Interessenskonflikte und Divergenzen treten hinter dem Primärziel der Handlungsfähigkeit zurück. Durch dominante bzw. charismatische Akteure kann eine gewisse Handlungskompetenz erreicht werden.
Im Anschluss daran entsteht in einem sich langsam öffnenden autokratischen Regime die „konstruktive Zivilgesellschaft“, innerhalb derer die zuvor notwendige Homogenität zugunsten partikularer Interessen langsam abgelöst wird. Die innerorganisatorische hierarchische Ordnung bleibt zwar bestehen, wird aber durch sich verstärkende binnendemokratische Entscheidungsprozesse ergänzt.
Demokratisierung und demokratische Konsolidierung ermöglichen es, den Weg zur dritten Phase, der „reflexiven Zivilgesellschaft“, zu beschreiten. Die Gewährleistung eines Handlungsrahmens innerhalb einer rechtsstaatlichen Ordnung macht es den zivilgesellschaftlichen Akteuren auf Basis eigener – inzwischen pluralistisch und demokratisch organisierter – Strukturen möglich, die ihnen zugedachten Aufgaben vollumfänglich wahrzunehmen. In diesem finalen Stadium erfüllen sie gemäß den Vorstellungen de Tocquevilles von einer selbst organisierten Gesellschaft eine Vielzahl staatsentlastender Funktionen, beispielsweise in der Wohlfahrtspflege. Indem sie den Staat so vor überfordernden Erwartungen und Ansprüchen schützt, trägt die idealtypisch entwickelte Bürgergesellschaft wesentlich zur Akzeptanz des politischen Systems und zur Stabilisierung des gesamtgesellschaftlichen Friedens bei.
Wie ist also nun – 23 Jahre nach Tschernobyl, fünf Jahre nach den Bürgerprotesten gegen die manipulierten Präsidentschaftswahlen von 2004 und nur wenige Monate vor der möglichen Abwahl des damaligen Hoffnungsträgers und heutigen Staatspräsidenten Wiktor Juschtschenko – die Verfasstheit und Funktionsfähigkeit ukrainischer zivilgesellschaftlicher Akteure im Lichte des skizzierten theoretischen Modells zu beurteilen?
Nachdem sich 1986 unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl eine breite Opposition in der Bürgerbewegung „Ruch“ zusammengefunden hatte, schien der erste Schritt auf dem idealtypischen Weg zur „strategischen Zivilgesellschaft“ getan. Die zunehmende Interessenheterogenität bei gleichzeitigem Fehlen starker organisatorischer Strukturen führte relativ schnell nach der ukrainischen Unabhängigkeit 1991 zur gegenseitigen Blockade und damit zur Marginalisierung der Zivilgesellschaft. Die Entstehung einer konstruktiven oder gar reflexiven Zivilgesellschaft wie im Merkelschen Modell erschien danach illusorisch.
Erst mit der „Sternstunde“ ukrainischen Bürgerengagements in den Wintermonaten 2004/2005 ließ sich die erneute Formierung einer strategisch agierenden Zivilgesellschaft unter Führung von Wiktor Juschtschenko und Julija Tymoschenko beobachten, deren gemeinsames Primärziel in der Durchführung transparenter Wahlen bestand. Die Wiederholung dieser ersten Phase zivilgesellschaftlicher Entwicklung erfolgte im Gegensatz zu den späten 1980er Jahren unter deutlich günstigeren Voraussetzungen: Über ein Drittel der Ukrainer partizipierte aktiv an den Demonstration während der „Orangenen Revolution“. Die – wenn auch selektiv und auf niedrigem Niveau – zunehmende rechtliche und finanzielle Unterstützung durch die ukrainische Regierung sowie eine engere Zusammenarbeit mit internationalen Partnern erleichterten zudem die Arbeitsbedingungen im Dritten Sektor. Zu keinem Zeitpunkt waren die Vorzeichen für eine optimale Entfaltung des Demokratisierungspotentials der ukrainischen Zivilgesellschaft besser. Wie aber gestaltet sich der Status quo?
Auch wenn ihre „Geburtenrate“ seit der Jahrtausendwende unübersehbar angestiegen ist, können über die gegenwärtige Anzahl zivilgesellschaftlicher Organisationen in der Ukraine keine gesicherten Angaben gemacht werden. Die Zahlen divergieren enorm: von 20.000 (laut Iryna Solonenko, Director Europe, International Renaissance Foundation) bis ca. 52.000 Organisationen (so Olha Ajwasowska, Information Director im Civic Network Opora). Grund dafür ist neben der Frage, welche Akteure zur Zivilgesellschaft zugehörig gezählt werden auch die Tatsache, dass eine große Anzahl de jure existierender Institutionen de facto nicht tätig ist. So kommt eine Studie des ukrainischen Counterpart Creative Center von 2006 zu dem Ergebnis, dass lediglich 4.000 NGOs in der Ukraine wirklich aktiv sind.
Zusätzlich zu diesen vagen Erkenntnissen über Organisations- und Aktivitätsgrad wird die Beurteilung des Entwicklungsstands der ukrainischen Zivilgesellschaft durch Zweifel an der tatsächlichen Autarkie zahlreicher Organisationen erschwert. Obwohl sich das monetäre Potential des Dritten Sektors laut dem NGO-Nachhaltigkeitsindex 2008 von USAID stetig verbessert und Finanzquellen diversifiziert werden, sind die meisten Organisationen von staatlichen und privaten Geldgebern aus dem (westlichen) Ausland abhängig. Diese beeinflussen über die Auslobung unterschiedlich hoch dotierter Projektzuschüsse („Grants“) das ukrainische Bürgerengagement maßgeblich.
Die langsame Erhöhung staatlicher Fördermittel, die nicht selten nach intransparenten Kriterien vergeben werden, dürfte die Emanzipation der Organisationen im Dritten Sektor kaum unterstützen. Und auch die zunehmende, jedoch nicht minder exklusive, Initiierung und Unterstützung zivilgesellschaftlicher Unternehmungen durch die ukrainische Wirtschaft – etwa durch die Oligarchen Wiktor Pintschuk oder Rinat Achmetow – scheinen wenig geeignet, die konsensualen zivilgesellschaftlichen Prinzipien Autonomie, Interessenpluralismus und Orientierung am öffentlichen Wohl zu gewährleisten.
Diverse im Juni 2009 in der Ukraine geführte Gespräche mit Vertretern des Dritten Sektors nähren den Verdacht, dass es sich bei der Tätigkeit eines erheblichen Teils der existierenden Organisationen eben nicht um selbstloses bürgerschaftliches Engagement, sondern um fremdfinanzierte und institutionell aufgeblähte „Wasserköpfe“ handelt. Diese simulieren uneigennütziges und am Gemeinwohl orientiertes Engagement im besten Falle über ihr hauptamtliches Personal; unter weniger günstigen Bedingungen vertreten sie lediglich die Interessen ihrer Klientel durch die Nutzung von persönlichen Beziehungen zu politischen Entscheidungsträgern. So tragen diese Organisationen kaum zur Stärkung des gesellschaftlichen Vertrauens in nachvollziehbare Aushandlungsprozesse bei. Gut gemeinte, vom Ausland über dessen Finanzierungspläne in die Ukraine hineingetragene Vorstellungen über wünschenswerte gesellschaftliche Entwicklungen verzögern durch ihre selektive Elitenorientierung selbstständige Zielidentifikationen möglicherweise eher, als dass sie eine nachhaltige Wirkung in der demokratischen Transformation entfalten. Das Überangebot an finanziellen Fördermöglichkeiten professionaliert mit Sicherheit die Mittelakquise aber nicht notwendigerweise das Bürgerengagement an sich. Dass sich mitunter selbst kleinste Mikroakteure in den ukrainischen Regionen überzeugt zeigen, ihre Vorstellungen ohne Soros und Co. nicht optimal umsetzen zu können, verdeutlicht das Dilemma. Entstehen so selbstbewusste und standhafte Akteure, die für die Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft im Sinne de Tocquevilles notwendig sind?
Neben dem Problem der finanziellen Abhängigkeit hinterlässt auch die Übernahme vermeintlicher „best practices“ aus der Organisationsentwicklung des Westens einen eher ambivalenten Eindruck. Das Modell einer hierarchisch gestuften Inklusion verschiedener Organisationsgliederungen beispielsweise kürzt den evolutionären Selbstfindungsprozess zivilgesellschaftlicher Initiativen zugunsten einer effizienten Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern sicher ab. Den langfristig notwendigen binnendemokratischen Lernprozessen ist dies mit Sicherheit nicht dienlich.
Das ukrainische bürgerschaftliche Engagement ist aufgrund der fehlenden Breitenwirkung sowie den zum Teil selbst auferlegten Autonomiebeschränkungen infolge der Fokussierung auf externe Finanzspritzen selbst dem Stadium der „konstruktiven“ Zivilgesellschaft nur bedingt zuzurechnen. Um ihre idealtypische „Vollendung“ im Sinne de Tocquevilles oder Dahrendorfs zu erfahren, d.h. von Staat und Individuum als hilfreicher und unverzichtbarer Partner zur Befestigung und Bewahrung der Demokratie wahrgenommen zu werden, braucht es allen materiellen Schwierigkeiten zum Trotz vor allem den Anspruch der Ukrainer, den zur demokratischen Konsolidierung eingeschlagenen Weg selbstbewusst und eigenständig weiterzugehen.
Dorothée Marth, M.A. und Andrea Priebe, M.A. sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Institut für Politikwissenschaft an der FSU Jena. Der Beitrag entstand in Folge der vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) geförderten Studienreise „Auf der Suche nach der ukrainischen Zivilgesellschaft“.
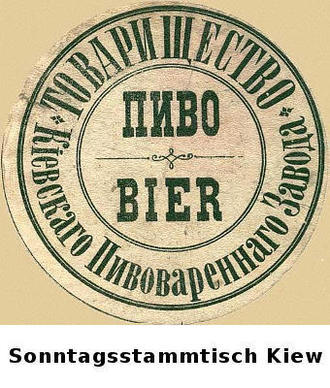

Forumsdiskussionen
Anuleb in Recht, Visa und Dokumente • Re: Verlängerung ukrainischer Reisepässe bei gesundheitlicher Einschränkung
„..... Mir liegen von meinen Eltern unterzeichnete Generalvollmachten in deutscher Sprache vor. ..... Grundsätzlich wirst du mit Vollmachten in deutscher Sprache bei einem ukrainischen Konsulat nicht weit...“
kasamb in Recht, Visa und Dokumente • Re: Verlängerung ukrainischer Reisepässe bei gesundheitlicher Einschränkung
„2016? Sorry, ich meinte 2026“
Frank in Recht, Visa und Dokumente • Re: Verlängerung ukrainischer Reisepässe bei gesundheitlicher Einschränkung
„2016? Das Konsulat ist doch in Hamburg. Warum rufst dort nicht an?“
kasamb in Recht, Visa und Dokumente • Verlängerung ukrainischer Reisepässe bei gesundheitlicher Einschränkung
„Sehr geehrte Damen und Herren, meine Eltern sind ukrainische Staatsbürger und leben seit 2008 mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis in Deutschland, genauer gesagt in Hamburg. Im Juni 2016 läuft...“
YbborNhurg in Hilfe und Rat • Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Hallo an ALLE, ich vermute meine Beteiligung hier entspricht nicht meinen Erwartungen und Hoffnungen. Mein Anliegen war in Erfahrung zu bringen,was ich beachten muss,wenn ich mit einer ukrainischen Frau...“
volontaer45 in Ukraine-Nachrichten • Re: Wegen des Starts einer russischen MiG wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen
„Das sind Untermenschen, normale Menschen verhalten sich anders. Slava Ukraine Nachricht von Moderator Handrij volontaer45 wurde für diesen Beitrag verwarnt. Nazisprache ist hier unerwünscht! Un|ter|mensch,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Hallo Lev, habe das im Internet gefunden, Probleme ist wohl die Grenzkontrolle ohne EU Pass, dann wird es eine Warterei von 2h..., Mein Browser hat mir das automatisch auf Deutsch übersetzt.“
lev in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Hat eventuell jemand hier im Forum, Erfahrung mit der neuen Zugverbindung und dem Umstieg in Przemyel ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Zuletzt war ich zweimal kurz hintereinander in Ustyluh/Zosin im Röntgenapparat (Polen), kostet halt jedes Mal auch noch ca. 15 - 20 Minuten..., das nervt. Nach Kiew würde ich ebenfalls die "nördliche"...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Kowel-Sarnyj-Korosten-Kiew, weil wesentlich weniger Verkehr als die A4-Route im Süden. Ach die Strecke kann man normal fahren? Da ist nur der Grenzübergang Dorohusk nicht möglich.“
Awarija in Ukraine-Nachrichten • Re: Wegen des Starts einer russischen MiG wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen
„Das macht ihn noch lange nicht zu einer Art Untermenschen.“
Frank in Ukraine-Nachrichten • Re: Wegen des Starts einer russischen MiG wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen
„Das hat sich spätestens erledigt seitdem "die Russen" ein Teil der Russen von damals hinterhältig überfallen hat. Und ein Teil der Russen von damals über "den Russen" von heute genauso denkt. Heisst...“
Awarija in Ukraine-Nachrichten • Re: Im vergangenen Jahr haben die Ukrainer ab 2022 eine Rekordzahl neuer Autos gekauft
„In diesem Zusammenhang würde mich ja Mal interessieren welche Rolle E-Autos in UA unter den derzeit herrschenden Bedingungen spielen ?“
Awarija in Ukraine-Nachrichten • Re: Wegen des Starts einer russischen MiG wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen
„Gerade wir als Deutsche sollten uns jetzt hüten wieder in alte verhängnisvolle Denkmuster gegenüber "den Russen" zu verfallen !“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ja das könnte passen. Der stand da mitten im Wald auf der Strasse mit der Kalaschnikow um den Hals. Da waren es noch paar km bis zur Grenze. Hatte da nur den EU-Pass gezeigt, hat er mich durch gewunken....“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin erst 2025 das erste Mal bei Uhryniv über die Grenze, der Blockposten ist Schätzungsweise 7 Kilometer von der Grenze weg. Ansonsten lässt sich noch vermuten ggf. Gibt da was in der Nähe, dass gerne...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Interessant, Blockposten gibt es an den anderen Grenzorten schon lange nicht mehr. Zumindest nicht in Budomierz oder Korczova, Astey, Kosun, Richtung Ungarn. Uhryniv .... Ist das nicht der wo Armeeposten...“
Bernd D-UA in Ukraine-Nachrichten • Re: Wegen des Starts einer russischen MiG wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen
„"RESPEKT " ist vermutlich das "Fremdwort" schlechthin für einen Russen. Meine Erwartungshaltung wurde " leider " nicht enttäuscht, faschistisches Russenpack, ist bleibt was es ist, ein Haufen voller...“
Frank in Ukraine-Nachrichten • Re: Wegen des Starts einer russischen MiG wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen
„Wieso Respekt? Werden die Russenfaschisten mit Absicht gemacht haben - wie kann man auch die Feiertage wie im Westen nutzen ....“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ja, das ist interessant, eigentlich sollen ja mit unter, Männer vor der Annäherung zur Grenze abgehalten werden und natürlich dann die Flucht außer Landes. Du hast recht, im Sommer hatte ich in Astey...“
Bernd D-UA in Ukraine-Nachrichten • Re: Wegen des Starts einer russischen MiG wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen
„War über die Feiertage in der Ukraine in Luzk bei der Familie, die Russen sind schon blöde Arschlöcher, Luzk als Stadt zählt meiner Ansicht nach auch eher noch zu den ruhigeren Plätzen im Kriegsgebiet,...“
Obm100 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Interessant, Blockposten gibt es an den anderen Grenzorten schon lange nicht mehr. Zumindest nicht in Budomierz oder Korczova, Astey, Kosun, Richtung Ungarn.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Grenzübergang Urgyniw - Dolgobytschuw Wollte in der Nacht von Samstag 3.1.26 auf Sonntag 4.1.26 am Grenzübergang Urgyniw um ca 2 Uhr ausreisen, daraus wurde aber nichts, da wir am "Blockposten" - Kontrollpunkt...“
Anuleb in Ukraine-Nachrichten • Re: WSJ: US-Geheimdienst dementiert den Angriff auf Putins Datscha
„Was wohl die Russen davon halten, dass die Ukrainer beinahe schon nach belieben jede Raffinerie erfolgreich angreifen können, Putins Residenz aber so derartig gut gesichert ist, sodass sie angeblich 91...“
Awarija in Ukraine-Nachrichten • Re: WSJ: US-Geheimdienst dementiert den Angriff auf Putins Datscha
„Was wohl die Ausgebombten aus Dnipro oder die Bauern im Kursker Gebiet denken wenn sie erfahren würden daß sich ihre Kriegsherren selbst gegenseitig nur mit Samthandschuhen anfassen ?“
Frank in Ukraine-Nachrichten • Re: WSJ: US-Geheimdienst dementiert den Angriff auf Putins Datscha
„Also bisher habe ich nichts davon gelesen dass es entsprechende Angriffe gab. Letztes Jahr gab es mal ein Ziel in der Nähe vom Präsidentenpalast. ... denke mal das läuft auf Gegenseitigkeit hinaus...“
Awarija in Ukraine-Nachrichten • Re: WSJ: US-Geheimdienst dementiert den Angriff auf Putins Datscha
„Mal ganz abgesehen davon daß dieses behauptete Ereignis vermutlich nur als Vorwand konstruiert wurde um sich vor ernsthaften Friedensverhandlungen drücken zu können: Putin scheint wohl ein schlechter...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin am 24.12.25 in Zosin/Ustyluh in die Ukraine eingereist, war das erste und einzige Auto, in ca. 45 Minuten durch gewesen. Ausreise nach Polen, ca. 10 PKW zu der Zeit.“
Frank in Ukraine-Nachrichten • Re: Kein Schahed, aber mit gelenkten Bomben: Die Russen setzen ihre Angriffe auf die Frontregionen fort
„Typisch Russenkasper welche vom korrupten Putin und der Machtelite um ihn herum verarscht werden. Zu mehr als zivile Ziele in Städten zu zerstören reicht es nicht.“
Anuleb in Ukraine-Nachrichten • Re: Kein Schahed, aber mit gelenkten Bomben: Die Russen setzen ihre Angriffe auf die Frontregionen fort
„Warum sollten die sich auch trollen?? Für mich ist es immer wieder eine Offenbarung, wenn man mal wieder feststellen kann, mit welch limitierten Fähigkeiten und Qualitäten jene Russlandfans unterwegs...“
lev in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Hallo Hendrij, habe mal ne Frage zu der neuen Zugverbindung Leipzig - Krakau - Przemyel. Wir fahren ja seit vielen Jahren immer mit dem Wohnmobil und im Winter mit dem Bus nach Lwiw. Da wir unweit von...“